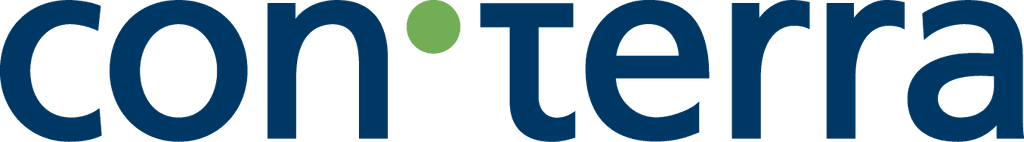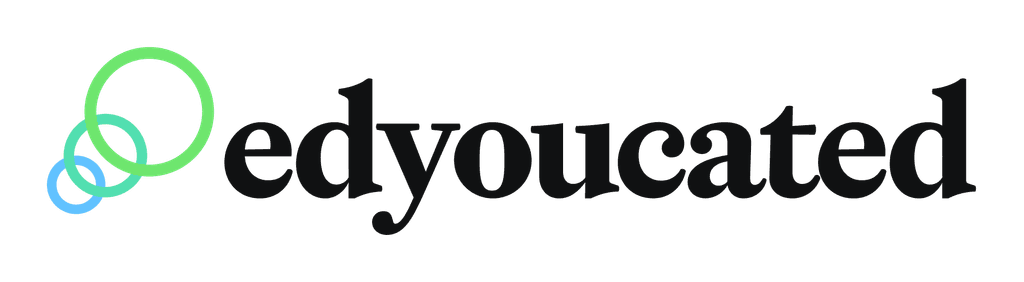Um uns im Weltraum wird zunehmend voller. Alleine Starlink betreibt über 8000 aktive Satelliten und Unternehmen wie OneWeb oder Amazon mit Project Kuiper ziehen nach. Doch was passiert, wenn die Dichte an Satelliten und Weltraumschrott einen kritischen Punkt erreicht? Eine mögliche und folgenschwere Antwort darauf ist das Kessler-Syndrom.
Dieses vom NASA-Wissenschaftler Donald J. Kessler beschriebene Szenario besagt, dass zufällige Kollisionen zwischen Objekten im Orbit eine Kettenreaktion auslösen können. Jede Kollision erzeugt dabei neue Trümmerteile, die wiederum die Wahrscheinlichkeit weiterer Kollisionen exponentiell erhöhen – mit der Gefahr, dass der Orbit für zukünftige Raumfahrt unbrauchbar wird. Besonders im sogenannten Low Earth Orbit (LEO), dem Bereich zwischen 200 bis 2.000 km über der Erdoberfläche, steigt die Zahl der aktiven Satelliten und des Weltraumschrotts kontinuierlich an. Wann genau der Kessler-Effekt eintreten könnte, lässt sich jedoch nicht exakt prognostizieren, da dies von einer Vielzahl komplexer Faktoren und nicht zuletzt vom Zufall abhängt. Genau hier setzt unser Projekt an. Wir wollten uns einen datengestützten Überblick über die Objekte im LEO verschaffen und die dahinterliegenden Mechanismen des Kessler-Syndroms greifbarer machen. Dafür haben wir eine interaktive Streamlit-Anwendung konzipiert, die aktuelle, öffentlich zugängliche Daten von CelesTrak visualisiert und sie dynamisch filterbar macht. Ergänzt wird die Darstellung durch eine bewusst vereinfachte Wachstumssimulation, die den Einfluss von Parametern wie Objektdichte oder Kollisionswahrscheinlichkeit auf den Eintrittszeitpunkt des Kessler-Syndroms veranschaulicht.
Unsere primäre Motivation für dieses Projekt war es, den kompletten Data-Science-Workflow von Anfang bis Ende durchzuspielen: von der Datenaufnahme über das Cleaning und die Analyse bis hin zum Prototyping eines Modells und schließlich zur Präsentation der Ergebnisse in einer Web-Anwendung.
Die Simulation dient dabei in erster Linie Lern- und Experimentierzwecken – sie erhebt keinen Anspruch auf physikalische Exaktheit. Vielmehr war sie für uns ein praktisches Übungsfeld, um mit Tools wie Pandas und NumPy ein anschauliches Data Science Product zu entwickeln und dabei die typischen Herausforderungen und Lernkurven eines solchen Projekts zu erleben.
Um das Kessler-Syndrom greifbar zu machen, haben wir einen klassischen Data-Science-Ansatz verfolgt. Der Prozess lässt sich grob in drei Phasen unterteilen: Datenbeschaffung und -aufbereitung, die Entwicklung der Kernlogik in Python und die Visualisierung mittels einer Streamlit-Webanwendung. Als Datenquelle für Objekte im Orbit dienten uns die öffentlich zugänglichen Datensätze von CelesTrak, die vom North American Aerospace Defense Command (NORAD) bereitgestellt und kuratiert werden. Wir haben vor allem den allgemeinen Satellitenkatalog (satcat) genutzt, der weitreichende Informationen zu jedem katalogisierten Objekt enthält.
Die Verarbeitung der Daten erfolgte mit Hilfe eines Python-Skripts, das maßgeblich auf der Pandas-Bibliothek basiert. Das Skript lädt die Daten von CelesTrak herunter. Um die Ladezeiten zu minimieren und wiederholte Anfragen an den Server zu vermeiden, werden die Daten lokal als CSV-Datei gespeichert. Für die Aktualisierung der Daten wurde ein entsprechender Button in die finale Anwendung eingebaut, der es ermöglicht die Daten auf Knopfdruck gezielt zu löschen und durch eine neue Version von CelesTrak zu ersetzen. Einer der aufwändigsten Schritte war das Data Cleansing und Preprocessing, wobei zunächst nur die Objekte aus dem LEO extrahiert wurden, also jene mit einem Apogäum und Perigäum von unter 2.000 km. Zudem wurden sämtliche Spaltennamen für eine bessere Lesbarkeit verändert und Datumsangaben sowie andere numerische Spalten in das korrekte Format konvertiert. Zuletzt wurden die Daten angereichert, indem eine eigene Kategorisierung eingeführt wurde, die Objekte in “Schrott”, “Satellit”, und “Raumstation” unterteilt und den Betriebsstatus in “Aktiv”, “Inaktiv” und “Zerfallen” anzeigt.
Damit die Daten und die Simulation zugänglich werden, haben wir eine interaktive Webanwendung mit Streamlit erstellt. Diese ist gegliedert in eine interaktive Datentabelle, einen Graph, der den kumulativen Anstieg der Objektanzahl im LEO visualisiert, und die tatsächliche Kessler-Simulation. Die interaktive Simulation ermöglicht es Nutzer*innen, verschiedene Parameter wie die Kollisionswahrscheinlichkeit oder die Anzahl der Trümmer pro Kollision über einen Schieberegler anzupassen. Daraufhin zeigt die Simulation in einem Graphen, wie sich die Anzahl der Objekte über die Zeit entwickeln würde. Hierbei ist zu betonen, dass es sich um ein stark vereinfachtes Modell handelt, das primär der Veranschaulichung dient und keine physikalisch exakte Vorhersage darstellt. Die Komplexität einer realitätsnahen Modellierung des Kessler-Syndroms hätte den Rahmen dieses Projekts bei Weitem gesprengt.
Unser Projekt lieferte uns sowohl technisch als auch inhaltlich wertvolle Erkenntnisse. Auf technischer Ebene war es besonders motivierend zu sehen, dass wir innerhalb weniger Monate eine Programmiersprache erlernen konnten und dieses Wissen direkt in einem funktionierenden Data-Science-Projekt anwenden konnten. Eine zentrale Erkenntnis war der tatsächliche Arbeitsaufwand der Datenaufbereitung – ein Aspekt, der oft unterschätzt wird. Doch die Realität zeigt: Die meiste Arbeit steckt im Data Cleaning und Preprocessing, nicht in der eigentlichen Analyse. Während der Arbeit erwies sich Pandas als äußerst leistungsstarkes Werkzeug für die Datenverarbeitung, während Streamlit es uns ermöglichte, ohne App-Entwicklungserfahrung eine benutzerfreundliche Oberfläche zu erstellen. Diese Kombination machte es möglich, unser Projekt verständlich und interaktiv zu gestalten.
Inhaltlich waren wir von der schieren Menge katalogisierbarer Objekte im LEO beeindruckt. Der von uns verwendete CelesTrak-Datensatz umfasst derzeit über 57.000 Objekte mit einer Größe von mehr als 10 cm. Knapp die Hälfte dieser Objekte ist tatsächlich noch nicht zerfallen und somit direkt relevant für potenzielle Kollisionsereignisse. Von diesen noch aktiven Objekten sind etwa 11.000 als "Schrott" zu klassifizieren, während rund 13.500 funktionsfähige Satelliten oder Raumstationen darstellen. Den Hauptanteil der aktiven Satelliten machen Kommunikationssatelliten aus. Dabei fällt besonders Starlinks Megakonstellation ins Gewicht, deren rasanter Aufbau seit 2020 den massiven Anstieg der Satellitenzahlen maßgeblich verursacht hat. Eine wichtige Erkenntnis ist auch, dass die Schrott-Entwicklung mit der zunehmenden Raumfahrt deutlich steiler ansteigt als die Anzahl an Satelliten und Raumstationen selbst. Plötzliche Sprünge deuten dabei auf Kollisionsereignisse, bei denen eine große Anzahl von Trümmern, also “Schrott”, entstehen. Diese liefern einen Vorgeschmack darauf, was das Kessler-Syndrom in größerem Maßstab bedeuten könnte. Interessant ist auch, was in unseren Daten nicht mehr zu finden ist. Navigationssatelliten wie GPS, GLONASS oder Galileo operieren in höheren Orbits und befinden sich somit außerhalb des LEOs.
Über die reine Datenanalyse hinaus liefert unser vereinfachtes Simulationsmodell zwar keine physikalisch exakten Vorhersagen, aber es macht die exponentiellen Dynamiken hinter dem Kessler-Syndrom greifbar. Es zeigt außerdem deutlich, wie das System auf Änderungen einzelner Parameter reagiert.
Letztendlich hat uns das Projekt nicht nur technische Fertigkeiten vermittelt, sondern auch ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen der modernen Raumfahrt und die Dringlichkeit nachhaltiger Weltraumnutzung.
GitHub Repo
https://github.com/JulianSelbach/TechLabs_Gruppe8.git
Quellenangabe
Kreative Gestaltung nach satellitemap.space
Team & Rollen
Julian Selbach
Mai Klingenberg
Mentor:in
Julia Norget